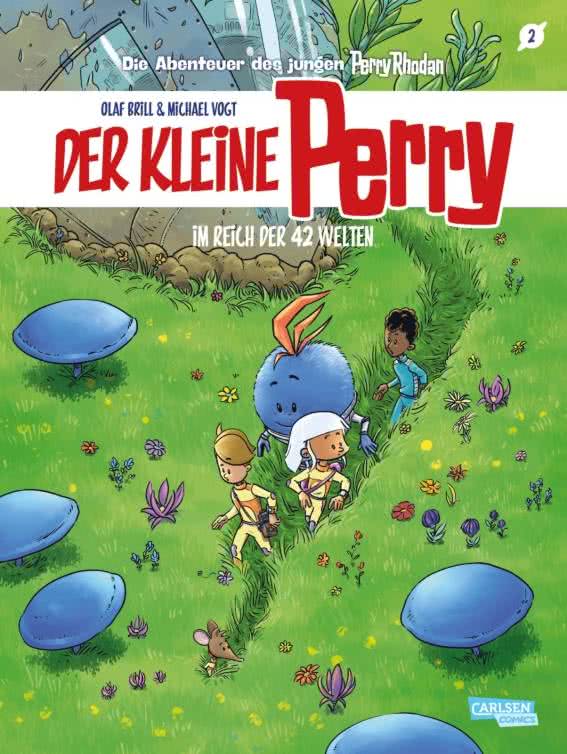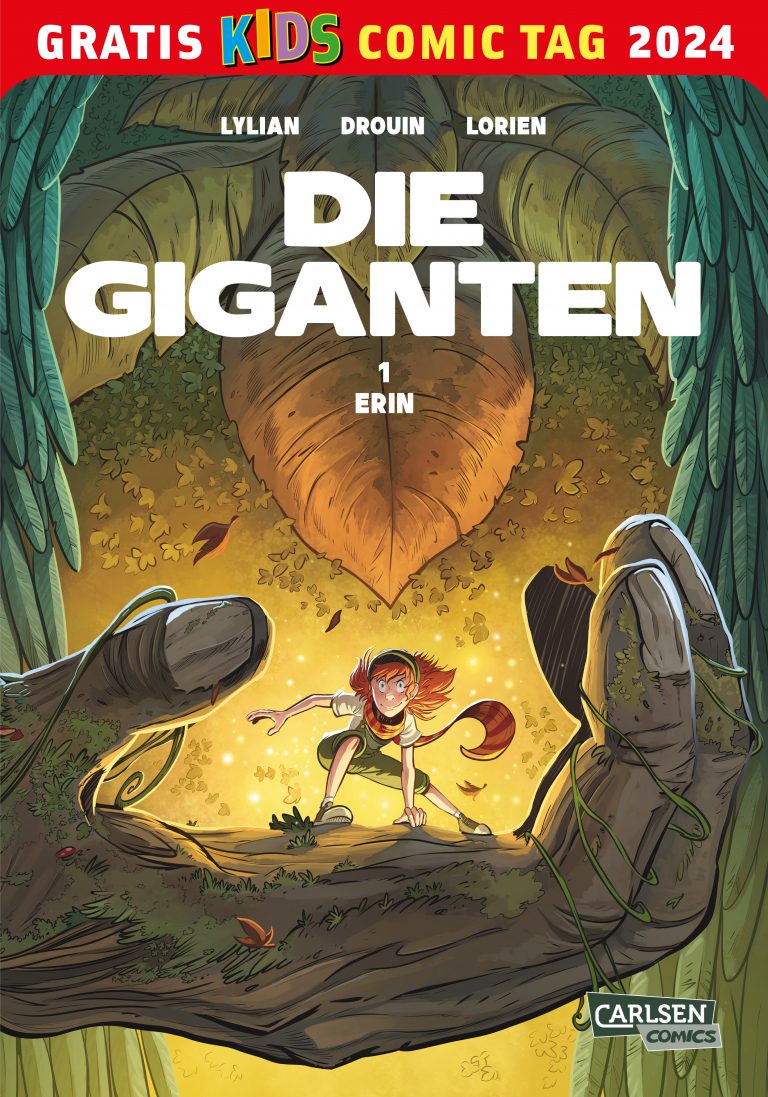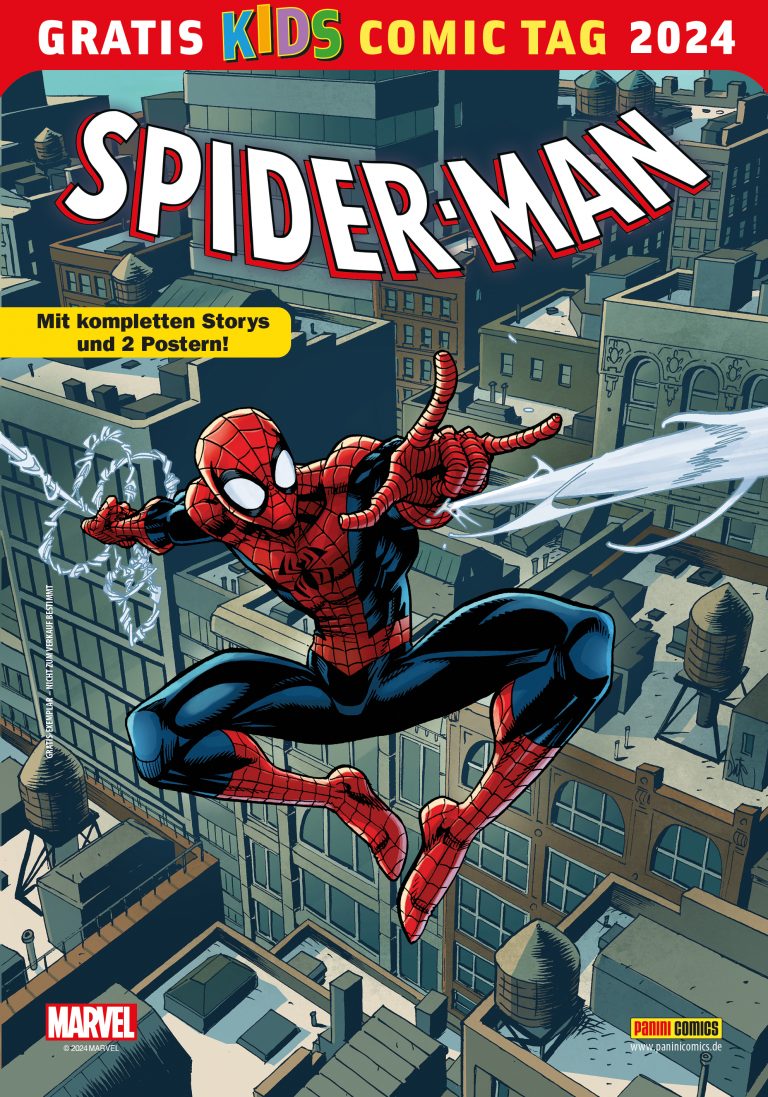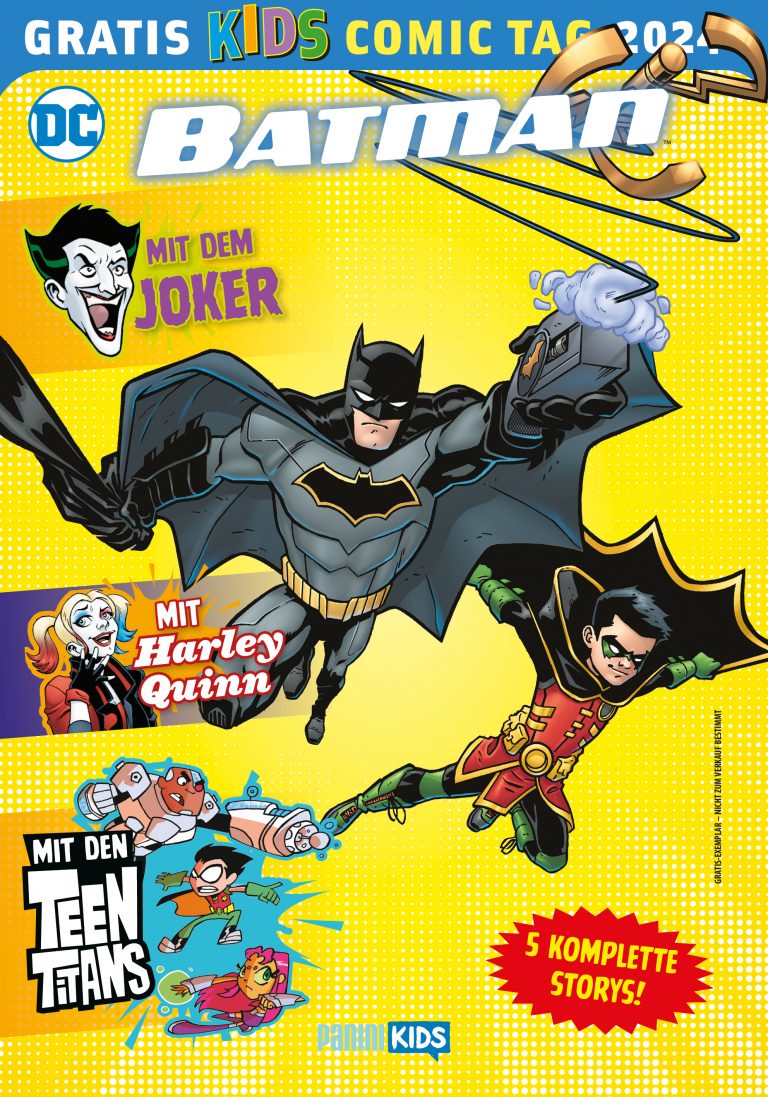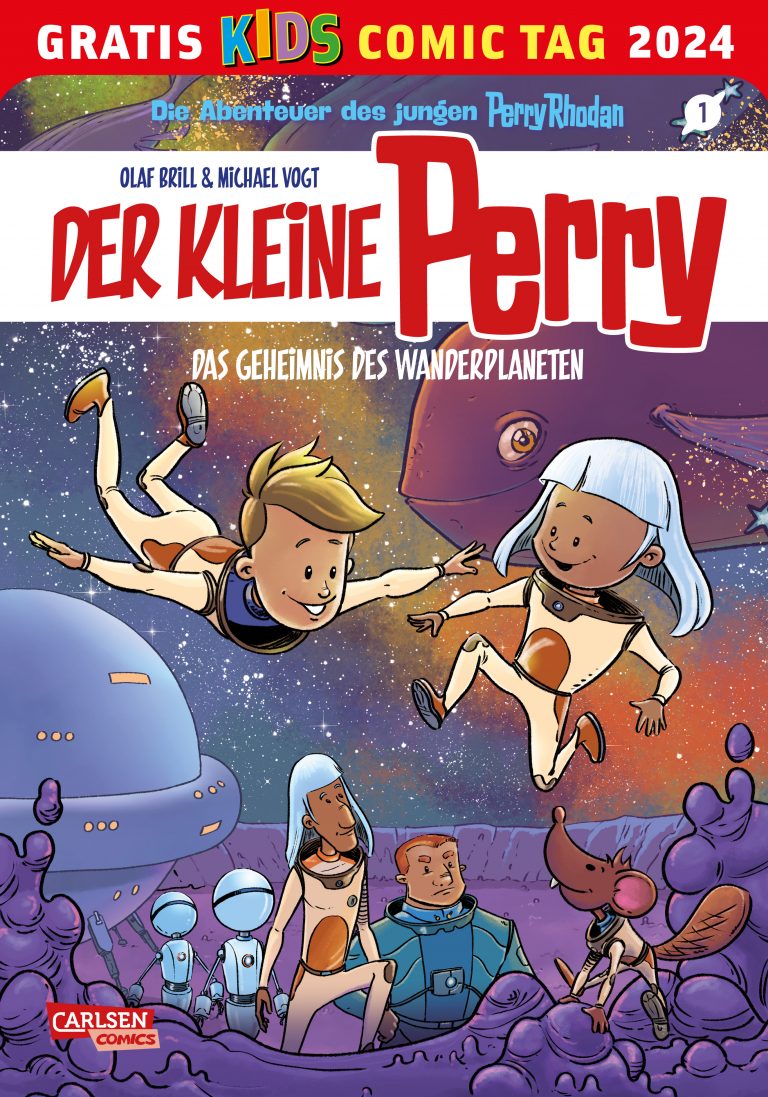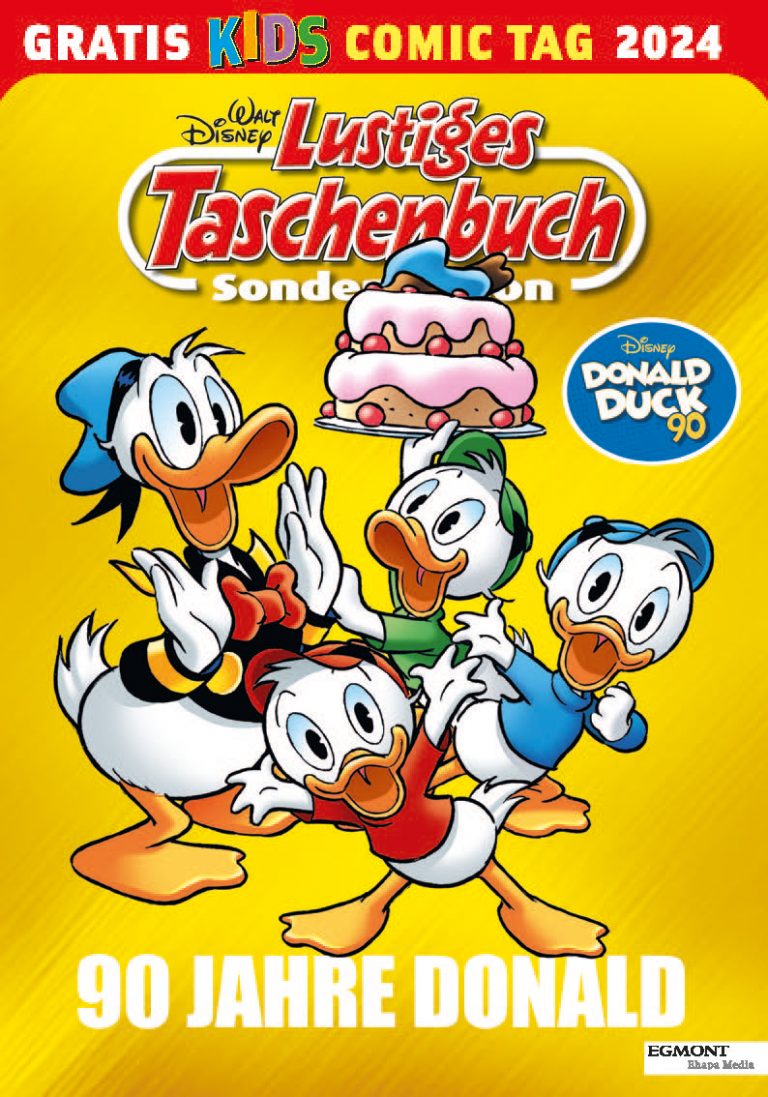Die zwölfbändigen Miniserien mit eigenständigen Abenteuern von #PerryRhodan und/oder Atlan gibt es schon eine ganze Weile. Bis auf den großartigen Erstling Traversan habe ich lange Zeit die meisten davon nicht gelesen. Seit der Miniserie Wega ist das anders. Seither ist es zumindest mein Anspruch, die jährlich erscheinenden Zwölfbänder immer mitzunehmen. Bei Androiden ist mir das mit leichter Verspätung wieder gelungen. Auch wenn meine Begeisterung nach dem ersten Viertel etwas nachgelassen hat, habe ich die Romane allesamt gern gelesen.
Roboterkrieg in der Milchstraße
Zum Inhalt will ich nicht allzu sehr ins Detail gehen,1 dennoch zur Sicherheit eine
WARNUNG VOR DEM SPOILER!
Aus heiterem Himmel tauchen Roboter in silbernen Kugelraumschiffen in der Milchstraße auf und greifen ohne Vorwarnung die friedlichen Bewohner etlicher Planeten an – offenbar in der Absicht, sie gnadenlos auszulöschen oder wenigstens von den Planeten zu vertreiben. Zu den ersten betroffenen Welten gehört der Planet Chentap, auf dem ein Volk von Amphibienartigen heimisch ist, das gerade die interplanetare Raumfahrt entdeckt hat. Ebenfalls vor Ort ist ein menschliches Wissenschaftsteam, das die Kultur dieser Wesen unentdeckt erforscht.
Parallel schwelt in der Föderation Normon, einem Teilstaat des Sternenreichs der Menschen, ein Sezessions- und Bürgerkrieg, in dessen Verlauf ein Flottenadmiral gedenkt, sich an die Macht zu putschen. Außerdem gewinnen auf der Erde KI-feindliche Strömungen an Einfluss, die durch den Angriff der Roboter zusätzlich befeuert werden.
Perry Rhodan höchstselbst – aktuell als „Kommissar zur besonderen Verwendung“ unterwegs – nimmt sich dieser Krise an, an seiner Seite sind Gucky und die künstliche Lebensform Aurelia Bina, ihres Zeichens stellvertretende Geheimdienstchefin.
Es stellt sich heraus, dass die Roboter und ihr aggressives Verhalten auf unterschiedliche Ereignisse der Erstauflagen-Handlung zurückgehen. Es handelt sich um die Androgyn-Roboter, die etwa tausend Jahre zuvor2 von den Menschen im intergalaktischen Leerraum ausgesetzt worden waren, um dort Stützpunkte für extreme Fernreisen anzulegen. Diese sind dem Ruf des Adam von Aures gefolgt, der 500 Jahre später das biologische Leben aus der Milchstraße vertreiben und künstliches Leben ansiedeln wollte.3
Mit etwas Mühe und vereinten Kräften können Perry, Gucky, Aurelia und die zusammengewürfelte Chentap-Truppe diese Hintergründe aufdecken und die Roboter befrieden. Dabei haben sie allerdings die Rechnung ohne den ehrgeizigen Flottenadmiral gemacht, der den Feldzug gegen künstliche Intelligenzen nicht aufgeben will und in dem Zuge zum Verteidigungsminister des Sternenstaats der Menschheit aufsteigt. Zudem taucht – erneut aus heiterem Himmel – mit den sogenannten Molochiden eine weitere Fraktion auf: Riesige Millionen Jahre alte mit künstlichem Bewusstsein versehene und schier unbesiegbare Asteroiden mischen sich in den Konflikt ein und fordern zum Schutz aller KIs die Auslieferung des besagten Flottenadmirals.
Erwartungsgemäß gelingt es den Heldinnen und Helden erst im buchstäblich letzten Moment, diese verfahrene Situation im Spannungsfeld einer KI-feindlichen Verschwörung auf der Erde, eines drohenden Militärputsches und der Bedrohung durch die Molochiden zu klären und alles zum Guten zu wenden.
Gelungener SF-Thriller mit Abzügen in der KI-Note
Wenn ich die Handlung der zwölf Hefte so noch einmal zusammenfasse, muss ich sagen: Das Ganze ist durchaus eine runde Sache. Gleichzeitig fallen mir nun leichte Parallelen zur ersten Picard-Staffel auf – aber das soll nun wirklich kein Kritikpunkt sein.
Besonders stark ist die Serie bei ihren Charakteren. Vor allem die eigens für diese zwölf Hefte entwickelte Truppe aus Forschenden, die unvermittelt in dieses kosmische Abenteuer geworfen werden, hat mir sehr gefallen. Für den zwielichtigen anti-heldenhaften Siganesen4 gilt dies ganz besonders. Die Chemie zwischen den ungleichen Figuren stimmt einfach und trägt große Teile der Handlung, so soll es sein. Auch wenn ihre gemeinsame Hintergrundgeschichte etwas herbeikonstruiert wirkt, vor allem was die beiden parapsychisch verbundenen Zwillingsschwestern betrifft. Dass eine davon die ganze Zeit im Koma auf dem Forschungsschiff mitfliegt, ohne dass jemand davon weiß, will mir nicht so ganz einleuchten.
Spaß hat auch die Einbettung in den Überbau der Gesamtserie gemacht. Für die Behandlung des KI-Themas die Androgyn-Roboter zu reaktivieren ist ebenso genial wie der Bezug zu Adam von Aures und seinen Ruf. Der damit geradezu zwangsläufig verbundene Besuch auf der Kunstwelt Wanderer zählt zu den Höhepunkten der zwölf Hefte.
Mein Lieblingsheft aber ist die Nummer vier und der darin beschriebene Besuch der „Menschenstadt“, worin das KI-Thema aus meiner Sicht am besten behandelt wird. Die Darstellung der durch Roboter simulierten Gesellschaft greift ehrenvolle Vorbilder wie „Welt am Draht“ oder „Dark City“ gekonnt auf. Ich mag das.
Leider gelingt das in den übrigen Heften nur bedingt. Ich hatte schon in der oben verlinkten Besprechung der drei ersten Hefte angemerkt, dass sich diese Miniserie – wie die gesamte PR-Serie – um die Klärung des Status künstlicher Intelligenzen herumdrückt, beziehungsweise bereits gemachte Ansätze wie das „Positronische Konkordat“ aus den 3050er Heften, ignoriert. Falls ich mich einmal selbst zitieren darf:
„Man gewinnt beim Lesen stets den Eindruck, als wären Status und Stellung künstlicher Intelligenzen in der beschriebenen Gesellschaft noch völlig ungeklärt, als würde es künstliche Intelligenzen erst seit relativ kurzer Zeit geben. Tatsächlich aber wird eine Welt beschrieben, in der Roboter schon seit Jahrtausenden – oder sogar seit Jahrzehntausenden, wenn man die Arkoniden, Tefroder, Akonen etc. einbezieht – eine absolute Normalität sind. So fühlt es sich oft aber leider nicht an.“
Zugegeben: Es ist in der Serienhandlung gerade einmal 500 Jahre her, dass die Milchstraße zugunsten künstlicher Zivilisationen entvölkert werden sollte. Dieser Aspekt war mir bei Lektüre der ersten drei Hefte tatsächlich nicht mehr gegenwärtig. Es ändert aber nichts daran, dass in der Verfassung eines jeden Sternenstaats im Perryversum irgendetwas zum Thema KI stehen muss.
Nun hat – auch das habe ich oft betont – die PR-Serie einerseits schon immer eine Schwäche, Gesellschaft einigermaßen glaubhaft darzustellen. Andererseits ist es auch nicht ihr Anspruch und Aufgabe, dies zu tun. Ich will an der Stelle mit Kritik also zurückhaltend sein.5
Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass nicht vergessen wird, dass in einer Gesellschaft nie nur die „Bösen“ am Werk sind. Wo war denn die KI-Community? Wo die Supporter? Wo die prominenten künstlichen Personen, die sich in die Debatte einbringen – allen voran Rico? Wo die Pro-KI-Demos? Was haben NATHAN und die Ylanten zu all dem gesagt?
Verhalten versöhnliches Fazit
Im letzten Heft der Serie wird alles wieder gut. Die Bösen werden auf die ein oder andere Weise ausgeschaltet, die Anti-KI-Verschwörung ausgehoben und der drohende Militärputsch abgewendet. Die Guten finden ihr Glück und ihren Frieden – allen voran Aurelia Bina, die, nachdem sie buchstäblich auseinandergenommen worden ist, wieder rekonstruiert und rehabilitiert wird. Künftig soll sie sogar oberste Chefin des Geheimdienstes sein. Ich mag Happyends, vor allem wenn es KI-Personen betrifft.
Kurz vor Schluss werden sie und ihre Mitstreiter allerdings noch einmal mit einem Dilemma konfrontiert, das mir nicht so recht einleuchten will und mir die Abschlussfreude etwas getrübt hat. Und zwar ist Aurelias Bewusstsein im Laufe der Handlung auf auf zwei Köpfe verteilt worden, die unabhängig voneinander Erinnerungen gesammelt haben und nun quasi zwei Personen geworden sind. Da sie beide in Zukunft nur als ein eigenständiges Individuum unterwegs sein wollen, können sie sich nicht einigen, wer von ihnen das sein soll – und wer seine Existenz beenden muss. Gar nicht mal als Streit, sie können dieses vermeintliche Dilemma einfach nicht lösen, bis eine ihrer menschlichen Freunde einfach eine Münze wirft.
Äh … War ihr WLAN kaputt? Oder ihr NFC? Hatten die kein USB-Kabel zur Hand? WIESO SYNCHRONISIEREN DIE NICHT EINFACH DIE KÖPPE? Nur ein paar Hefte davor hat Perry selbst sein Bewusstsein in tausende Splitter aufteilen und wieder zusammensetzen müssen – aber zwei zu 99% identische KIs können nicht zusammengeführt werden?
––––––––––––- kurz wird’s trotzdem nicht[↑]
- zu lesen in den 1600er und 1700er Heften, die in den 90er Jahren erschienen sind[↑]
- zu lesen in den 2900er Heften, die vor gut fünf Jahren erschienen sind[↑]
- Menschenabkömmlinge, die im Laufe einiger tausend Jahre Evolution auf eine Größe zwischen zehn und 15 cm geschrumpft sind[↑]
- Davon, dass ein Regierungskommissar offenbar komplett ohne Stab, Behördenapparat und Budget unterwegs ist, will ich gar nicht erst anfangen.[↑]